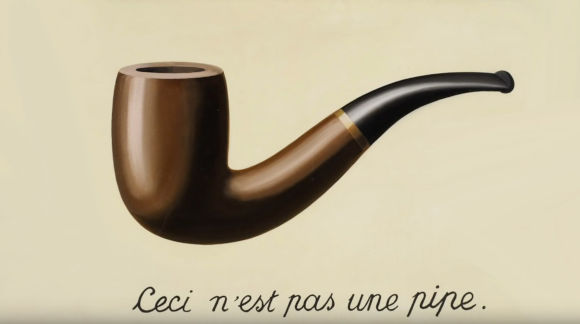Soziologisches zu Cannabis als Medizin
Die Soziologin Frau Prof. Dr. habil. Gundula Barsch, Hochschule Merseburg, sieht (hier) eine beklagenswerte Unterversorgung der deutschen Bevölkerung mit Cannabis. Aber sie sieht auch einen Ausweg. Wir wollen herausfinden, was es mit dieser Bestandsaufnahme, die zwei Druckseiten einer überregionalen linken Tageszeitung einnimmt, auf sich hat. Zunächst schildert sie die aktuelle Situation. Da sei einmal die … Weiterlesen