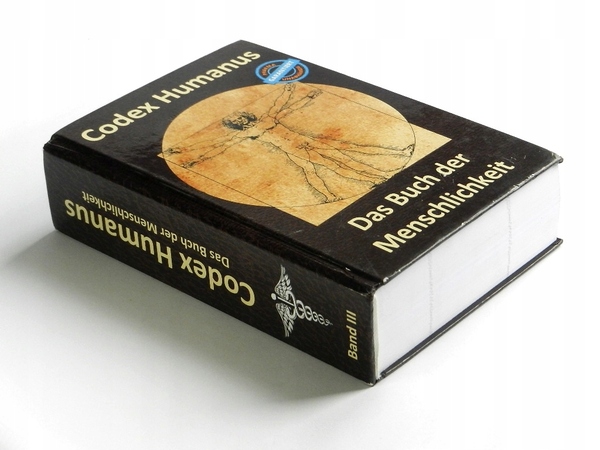MMS (Miracle Mineral Supplement) Opfer gesucht!
Für einen Fernsehbeitrag (ARD, im März, Sendezeit 20.15 Uhr) suchen wir DRINGEND ein MMS-Opfer, das bereit ist, vor der Kamera auszusagen. Kontakt: info@psiram.com. Alle Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. MMS ist immer wieder Thema bei uns, Beiträge dazu findet man mit https://blog.psiram.com/?s=mms Weitere Hintergrundinformationen im Psiram-Wiki Es wäre schön, wenn unsere Leser diesen Aufruf möglichst … Weiterlesen